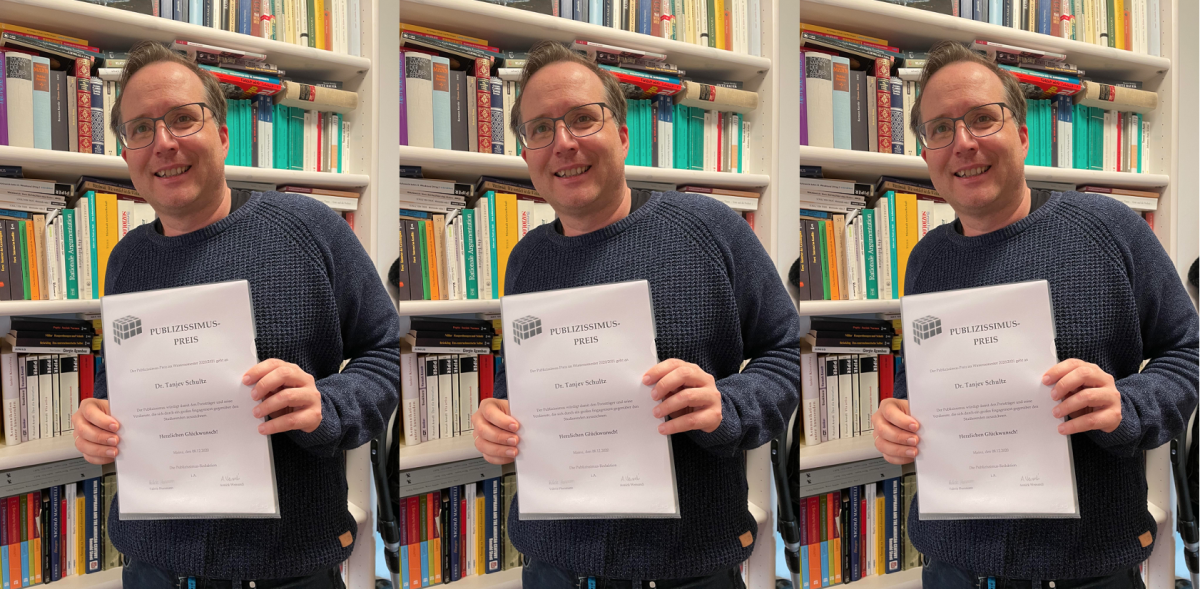Herr Schultz, herzlichen Glückwunsch zum Publizissimus-Preis! Mit diesem Preis möchten wir Sie für ihr großes Engagement in der Lehre auszeichnen und für Ihre Vorlesungen und Seminare, in denen Sie Ihre journalistische Berufserfahrung miteinfließen lassen. Nun haben Sie schon mehrere Journalistenpreise gewonnen, was bedeutet Ihnen der Publizissimus-Preis?
Ob Sie es glauben oder nicht, das bedeutet mir sehr viel. Tatsächlich ist es der erste Preis, den ich für meine Lehre bekomme und die Lehre ist nun mal ein ganz wichtiger und zentraler Bereich im Leben eines Hochschullehrers. Es ist ja so, dass ich sehr gerne Journalist war oder noch bin, aber eben auch diese Freude daran habe, etwas beizubringen oder zu lehren. Daher ist das für mich überraschend, aber sehr schön, den Preis zu bekommen.
Dieses Wintersemester ist bereits das zweite Online-Semester, viele Erstis haben den Campus selbst noch nicht mit eigenen Augen gesehen. Was vermissen Sie an der Präsenzlehre am meisten?
Ich vermisse vor allen Dingen diese Spontanität, mal zu einem Gespräch zu finden. Einerseits zwischen Tür und Angel, auch in den Instituten, wenn man sich einfach begegnet, aber auch in den Lehrveranstaltungen, dass sich da etwas ergibt. Ich glaube, wir sind mittlerweile alle erfahren genug mit den digitalen Formaten, dass da schon manche Dinge möglich sind, aber die Spontanität fehlt. Wenn ich in der Präsenzlehre merke, dass die Konzentration bei den Studierenden absackt, kann ich ein anderes Tempo einlegen. Das geht in der digitalen Lehre, wo man sich nicht persönlich gegenübersitzt, deutlich schlechter. Was ich sehr schade finde, ist, dass Sie als Studierende sich nicht wie sonst untereinander „anstacheln“ und voneinander lernen können. Man vertieft den Lehrstoff automatisch, selbst wenn man nur ein bisschen miteinander darüber lästert oder Witze macht. Das ist eine ganz andere Art, mit den Lerninhalten umzugehen, als wenn man als Einzelkämpfer zu Hause sitzt.
Antworten auf Mails dauern bei Ihnen selten länger als ein paar Minuten, uns haben Sie bei dieser Interview-Anfrage auch noch zu später Stunde geantwortet – das dauert bei vielen anderen Dozierenden oft länger. Sind Sie eine Nachteule oder haben Sie einen persönlichen Wichtel, der Ihnen beim Antworten hilft?
Also meine Kolleginnen und Kollegen werden mich hassen, wenn ich das jetzt sage, aber es ist so, dass es ein bisschen mein innerer Ehrgeiz ist, auf studentische Mails möglichst schnell zu antworten. Das war jetzt natürlich ein bisschen ironisch gemeint und ich will meine Kolleginnen und Kollegen da überhaupt nicht schelten, wir haben alle viele verschiedene Aufgaben und eine ziemlich große E-Mail-Flut. Da liegt das ein oder andere vielleicht auch mal länger. Mein Anspruch ist aber, möglichst rasch zu antworten. Den habe ich erstens, weil ich selbst ein ziemlich ungeduldiger Mensch bin und froh bin, wenn ich die Dinge erledigt habe und ich es nicht mag, wenn das überhandnimmt.
Und Zweitens…
…ist es gewissermaßen ein Teil meiner Lehr-Idee. Ich habe, als ich selbst noch Student war, in Berlin an der FU angefangen zu studieren, einer großen Uni, und habe das dort als ziemlich anonym empfunden. Der Kontakt zu den Lehrenden war distanziert, es waren sehr viele Studenten. Die Lehrenden waren teilweise für niemanden greifbar, das fand ich schade. Dann habe ich ein Jahr in den USA studiert, da war es völlig anders: offene Türen, sehr schnelle Reaktionen auf E-Mails. Das hat mich beeindruckt. Zumindest ein bisschen von dieser amerikanischen Kommunikationskultur versuche ich in meinem eigenen Lehrverhalten auch umzusetzen. Jetzt habe ich natürlich große Angst, wenn Sie das publizieren, dass ich das für immer vorgehalten kriege, wann immer ich nicht rechtzeitig antworte oder was vergesse (lacht).
Mit dem Preis wollen wir Sie auch für ihren Beitrag zum kritischen Journalismus auszeichnen. Mit der Plagiatsaffäre von Karl-Theodor zu Guttenberg, den Missbrauchsfällen in der Odenwaldschule und den NSU-Prozessen waren Sie an vielen wichtigen medialen Ereignissen der letzten Jahre sehr nah dran. Das sind ja doch Abgründe, die sich da auftuen – wie schaffen Sie es, die Balance aus Distanz und Nähe zum Berichtsgegenstand aufrecht zu erhalten?
Das war manchmal schwierig und es gab auch Phasen, wo mich das schon, “verfolgt” ist vielleicht zu viel gesagt, aber schon stark bis in meine Freizeit hinein beschäftigt hat. Da musste ich dann sehen: „Okay, ich muss ein bisschen Abstand gewinnen“. Das war schon ein Thema, aber insgesamt geht es und ich glaube, ich bin ein ziemlich sturer Typ, der das ganz gut wegschieben kann. Das war bei diesen Themen auch notwendig, die alle nicht sehr angenehm waren, bei denen man viele komplizierte Gespräche hatte. Das ging gut insgesamt, aber es gab immer mal Momente, in denen ich dachte „jetzt wird mir das aber auch ein bisschen viel“.
Sie haben die NSU-Prozesse intensiv begleitet und sind Co-Autor eines Buchs über diese. Nun kritisieren Sie auf Twitter die Ermittlungen zu NSU 2.0 als „zersplittert und zu zögerlich“. Wie fühlt es sich an, wenn die die gleichen Fehler wieder passieren?
Das ist schon frustrierend, vor allen Dingen treten Fehler und Probleme auf, die schon so lange auch in den Sicherheitsbehörden existieren. Gleichzeitig ist zu sehen, wie der Rechtsextremismus leider noch an Dynamik gewonnen hat. Die Gewalttaten in Halle, Hanau, der Mord an Walter Lübcke, diverse Anschläge. Das Positive, was ich allerdings sehe, ist, dass zumindest im öffentlichen Diskurs jetzt stärkere Aufmerksamkeit da ist und die Sensibilität auch bei den Sicherheitsbehörden gewachsen ist. Jetzt ist erkennbar, dass mit mehr Vehemenz versucht wird, Strukturen frühzeitig zu zerschlagen und dagegen vorzugehen. Da sehe ich eine gewisse Änderung inzwischen.
Sie haben den Redakteurs-Schreibtisch zumindest vorerst gegen das Uni-Büro getauscht. Was vermissen Sie aus ihrem damaligen Arbeitsalltag und was nicht?
Was ich nicht vermisse, ist das permanente Hängen mitten im Nachrichten-Wahnsinn. Das war auch ein Thrill und hat mich zeitweise gereizt, aber irgendwann nervte es. Dass man sich nie gedanklich ausklinken und die Dinge an sich vorbeiziehen lassen konnte. Jedes Wochenende ist etwas los, man muss hinterher oder möglichst voraus sein und die anderen Medien verfolgen. Dass man zum Getriebenen wird, das vermisse ich nicht. Was ich manchmal vermisse, ist dieses Redaktionelle, dieses Kollektiv, das sehr anregend sein kann. Was ich auch vermisse, ist diese schnelle Reaktion, von einem Moment auf den anderen etwas zu schreiben. Notfalls innerhalb einer Stunde zu sagen, „da ist jetzt ein kurzer Kommentar fällig, den schreibe ich jetzt“, zumindest, wenn die Redaktion einen lässt.
Gibt es die Überlegung Ihrerseits, in eine Redaktion zurückzukehren?
Das steht jetzt nicht an, aber ich würde das nie völlig ausschließen. Das Leben ist ja oft kurvenreich, aber ich bin ganz zufrieden mit der Tätigkeit in der Lehre und in der Forschung und der Möglichkeit, trotzdem noch Sachen schreiben zu können. Zwischen Wissenschaft und Journalismus, das finde ich im Moment sehr reizvoll.
Sie sind nun schon eine Weile im Journalismus: Was ist nach 13 Jahren bei der SZ die skurrilste Geschichte, die Ihnen im Laufe der Jahre passiert ist?
So richtig viel Komisches ist mir leider gar nicht passiert, aber ich habe mich mal monatelang mit einer Quelle immer wieder zum Kuchen-Essen getroffen. Das war immer in verschiedenen Cafés in der Innenstadt in München. Irgendwann hatte ich dann den Eindruck, es ginge vor allem ums Kuchen-Essen (lacht). Eigentlich ging es bei dieser Quelle um Terrorismus. Ich hatte am Anfang den Eindruck, dass das interessant werden könnte, aber es führte am Ende inhaltlich zu gar nichts. Es hat höchstens die Konditorei-Branche gestärkt und zu Pfunden bei mir und der Quelle geführt.
Neun Stunden verbringen wir täglich vor TV, Smartphone, Zeitungsseiten oder Radiogerät. Wie sieht Ihr täglicher Medienkonsum im Alltag aus? Nehmen Sie uns doch mal beispielhaft mit.
Das beginnt morgens damit, dass ich auf dem Smartphone die ersten Nachrichten lese. Da gucke ich durch die Nachrichten-Apps von Zeit, Spiegel, New York Times oder Süddeutscher Zeitung. Dann mache ich oft schon eine frühe Emailrunde oder ein erstes Teams-Gespräch. Die Zeitungen, die ich dann noch im Print-Abo habe, sind die Allgemeine Zeitung und die Süddeutsche, was Tageszeitungen angeht. Ich leiste mir jetzt den Luxus, manchmal zwei, drei Tage die Printausgabe liegen zu lassen und dann erst zu lesen. Das hätte ich früher als Journalist nicht gekonnt.
Dann gibt es meistens zwei, drei Teams-Sitzungen oder ich nehme kleine Lernvideos auf. Wir sind ja keine YouTube-Stars. Wir reden dann, sehen kein Publikum, haben nur unsere Folien vor uns und quatschen irgendetwas. Ich muss sagen, bei allem Engagement, für das ich gewürdigt werden soll: Ich habe permanent ein schlechtes Gewissen, weil man das alles noch besser machen könnte. Bei meinen Lernvideos habe ich keinen Perfektionsanspruch. So vergeht der Tag und dann hat man noch eine Konferenz oder eine Teambesprechung mit den Mitarbeitern. Die Tage gehen erstaunlich schnell vorbei, auch wenn man gar nicht viel unterwegs sein kann.
Abgesehen von Zeitungen und wissenschaftlichen Papers: Was lesen Sie so privat?
Generell habe ich ein gewisses Faible für Klassiker, öde könnte man sagen. Für Thomas Mann und Fontane kann ich mich immer begeistern, Lessing finde ich auch ganz großartig. Das Drama ist, dass ich eher viel zum Sachbuchlesen komme, weil ich die ziemlich schnell verschlinge. Für Literatur, also Belletristik, braucht man eine ein bisschen gelassenere Rezeptionshaltung, man muss sich eher darauf einlassen. Ich wünschte, ich würde dafürmehr Ruhe finden.
Mit welcher prominenten Person würden Sie gerne mal einen Kaffee trinken gehen?
Mit Angela Merkel würde ich schon gerne einen Kaffee trinken gehen.
Und über was reden?
Ich würde versuchen hervorzulocken, wie sie wirklich über manche Dinge denkt. Man hat den Eindruck, dass sie über vieles durchaus klare Meinungen hat, diese aber sehr geschickt diplomatisch versucht, nicht unbedingt zu verschleiern, aber politiktauglich zu machen. Ich glaube, das könnte ein ganz interessantes Gespräch sein, wenn sie sich da öffnen würde (lacht). Würde sie wahrscheinlich nicht, aber das fände ich spannend.
Was wollen Sie noch erreichen, beruflich oder privat? Gibt es Ziele oder Wünsche?
Den Publizissimus-Preis habe ich ja schon gewonnen, was soll jetzt noch kommen? (schmunzelt). Ich habe kein großes Ziel und eigentlich auch keinen Wunsch – ich bin hobbylos und wunschlos.
Viele Publizistik-Studierende haben den Traumberuf Journalist*in: Was ist das Wichtigste, was Sie den Studierenden und angehenden Medienschaffenden mitgeben können?
Einfach machen! Einfach beherzt reingehen ins Feld Journalismus, das geht von allen möglichen Richtungen aus. Es lebt sehr davon, dass man sich mit Engagement reinwirft, Kompetenzen erwirbt und diese zur Geltung bringt. Aber das können ganz unterschiedliche Sachen sein und da muss man sich natürlich ein bisschen trauen, manchen Frust auch mal aushalten können. Es klappt vielleicht nicht immer alles sofort. Aber ich glaube, wer möchte, kann auch. Wir brauchen weiter gute Journalistinnen und Journalisten, also nur zu!
Herr Schultz, vielen Dank für das Interview!